
Damals war oft anders: Quellenkritik, Recherche und weshalb „historisch korrekt“ kein Argument ist
„Damals war das aber so.“ Wer hat dieses Argument im Diskurs um historische Fiktion noch nicht gehört? Meist fällt es als Totschlagargument, um Diskussionen rund um unseren modernen Umgang mit Geschichte in der Popkultur endlich gar nicht erst entstehen zu lassen, denn wer kann schon gegen historische Korrektheit argumentieren? Entweder etwas „war damals so“, oder es war eben nicht so. Oder? Nein. Denn dieses „damals“, das angeblich so oder so war, war oft ganz anders als gedacht und ist auch gar nicht so leicht zu definieren, wie man meinen könnte. Denn eine offizielle „richtige Wahrheit“ kann es gar nicht geben, wenn wir über Geschichte sprechen. Geschichte ist Interpretationsarbeit, ein Zusammensetzen kleiner Teile zu einem großen Ganzen, von dem die meisten Stücke fehlen.
Wer mit Geschichte arbeitet, auch als Autor*in von Unterhaltungsliteratur, muss sich bewusst man, dass es keine klaren Antworten gibt, keine eine allgemeingültige historische Wahrheit und schon gar kein „Damals war das aber so!“ Wie das zusammenhängt und weshalb es trotzdem eine Art historische Authentizität geben kann und sollte, möchte ich heute etwas genauer ausführen. Denn zwischen der Idee vom rigiden „Damals“ und dem ebenso nicht unkritischen „Ist mir egal, wie es damals war, ich schreibe ja nur zur Unterhaltung“ entfaltet sich ein ganzes Spektrum aus historischen Möglichkeiten und Interpretationsvorlagen, dass es sich immer zu entdecken lohnt. Denn wer sich auf das komplexe Feld Recherche einlässt, wird am Ende die besseren Romane schreiben.
Quellen & Interpretationen: Wer schreibt Geschichte?
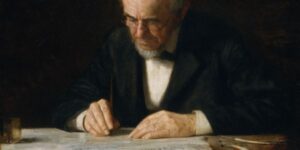
Von einer festgefahrenen Idee müssen wir uns jedoch gleich zu Beginn verabschieden: Historische Ereignisse lassen sich in den seltensten Fällen eins zu eins rekonstruieren, schon gar nicht durch die Linse eines fiktiven Unterhaltungsromans. Zu einigen Epochen und Ereignissen ist die Quellenlage natürlich trotzdem deutlich besser als für andere. Zum Vierten Laterankonzil 1215 in Rom lässt sich unweigerlich mehr Quell- und Recherchematerial finden, als zum Leben der einfachsten Bevölkerung im römischen Umland zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Generell gilt: Je wichtiger ein Ereignis oder eine Person von den Zeitgenossen (und später von den Historiker*innen, die dazu arbeiten) wahrgenommen wurde, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Quellenlage gut ist.
Hier deutet sich auch gleich der erste Stolperstrick an: Geschichtsschreibung ist nicht neutral. Allein deshalb kann ein Argument wie „Damals war das aber so“ gar nicht funktionieren, denn es gibt keine neutralen Fakten, die so ein klares, unumstößliches „Damals“ ergeben könnten. Die Quellen, mit denen wir arbeiten, primär oder sekundär, sind immer geprägt von den Personen, die sie erstellt haben, vom Zeitgeist ihrer Entstehungszeit und nicht selten ganz bewusst von politischen oder sozialen Zielen, die über diese Geschichtsschreibung validiert werden sollten. Das nennt man in der Geschichtswissenschaft einen „Bias“, von dem keine von Menschen erstellte Quelle wirklich frei sein kann, und der eine gründliche Quellenkritik – Also das kritische Hinterfragen des Informationsgehalts von Quellen – unbedingt nötig macht.
Ein wichtiges Werkzeug für eine gelungene Recherche und Quellenkritik ist deshalb ein Verständnis dafür, dass nicht nur Quellenentstehung vom Bias geprägt ist, sondern auch Quellenüberlieferung: Viele Primärquellen stammen von Menschen, die Macht und Einfluss hatten, sowie ein Interesse daran beides mithilfe der Geschichtsschreibung zu validieren. Primärquellen, die die Perspektive von einfachen Menschen oder sogar von unterdrückten Minderheiten spiegeln, sind deutlich seltener. Trotzdem kann eine Suche nach exakt solchen Quellen niemals ausbleiben, denn erst das Vergleichen verschiedener Quellen und Perspektiven zum selben Thema lässt eine informierte Interpretation zu. Dasselbe gilt für Sekundärquellen, denn während gute Historiker*innen sich ihrerseits immer auf Quellen stützen, haben auch sie einen Bias, eine historische These, von der sie ihre Lesenden überzeugen möchten.
Die „eine historische Wahrheit“ gibt es nicht
Aus dieser Herangehensweise – einer gründlichen Recherche, einer kritischen Einordnungen verschiedenster Quellen zum historischen und gesellschaftlichen Kontext – ergibt sich die Erkenntnis, dass es keine „eine historische Wahrheit“ geben kann, keine unumstößlichen Fakten, bald von allein. Speziell für Autor*innen von historischer Unterhaltungsliteratur gilt, dass das Streben nach „historischer Korrektheit“ und einer 100% „korrekten“ Darstellung von vornherein ein Kampf gegen Windmühlen ist, denn historische Fiktion kann inhärent schon gar nicht 100% „historisch korrekt“ sein – Deshalb ist sie Fiktion. Die besseren, komplexeren Romane entstehen, wenn mit den Möglichkeiten und dem Interpretationsraum gearbeitet wird, den Geschichte offen lässt. Die Quellenlage und eine gute Recherche können ein Leitfaden sein, aber sie sind kein Käfig, aus dem man nicht ausbrechen kann.
Wer sich auf die gelesenen Quellen – Oder das Fehlen von Quellen zu einem bestimmten Thema – beruft, um gewisse historische Umstände als 100% bewiesen oder 100% unmöglich darzustellen, macht es sich zu einfach. Man könnte die löchrige Quellenlage zur Demografie der ländlichen Bevölkerung in Böhmen im vierzehnten Jahrhundert so auslegen, dass es dort einfach keine nicht weißen Menschen gegeben hat. So legten es sich zum Beispiel die Entwickler des vor einigen Monaten heiß diskutierten Historien-RPGs „Kingdom Come: Deliverance“ zurecht, als sie auf das Fehlen nicht weißer Menschen in ihrem Spiel angesprochen wurden. Das Spiel, so hieß es, sie eben „historisch korrekt“, deshalb könne man einfach keine People of Colour einbinden, selbst, wenn man wollte. Dabei können Quellen immer nur Auskunft über das geben, was sie erwähnen. Nicht über das, was sie nicht erwähnen.
Und das, was sie nicht erwähnen, sind oft Ereignisse, Menschen, soziale Umstände, die entweder von den Zeitzeug*innen als nicht wichtig genug empfunden wurden, um ihre Existenz festzuhalten – oder schlicht und ergreifend als zu alltäglich. Ist dieses RPG, das auf fünfzehn Quadratmetern des mittelalterlichen Böhmens spielt und keinerlei nicht weiße Menschen einbindet, jetzt „historisch korrekt“ oder nicht?
Die große historische Ausrede
Ob ich in meinem historischen Roman nichtweiße Figuren, LGBTQ Figuren oder andere marginalisierte Figuren einbinde, ist eine Entscheidung und das ist auch das, von dem ich mir erhoffe, dass der ein oder andere es aus diesem Artikel mitnimmt. „Aber damals im vierzehnten Jahrhundert gab es in Böhmen keine nichtweißen Menschen“ ist, auch wenn es als solcher präsentiert wird, kein historischer Fakt. Es ist die Interpretation von Geschichte der Person, die diese These aufstellt. Eine These, der – wie immer – ein Bias unterliegt.
„Damals gab es diese Menschen dort nicht“ ist also eine Ausrede. Eine historische Geschichte in dieser Zeit anzusiedeln und nur weiße Figuren mitspielen zu lassen, ist kein nobler Schachzug im Namen der „historischen Korrektheit“. Es ist eine Entscheidung, die man als kreativer Mensch trifft und, dass so viele nicht hinter dieser Entscheidung stehen können und „historische Korrektheit“ vorschieben, um sie zu rechtfertigen, ist zumindest in meinen Augen schon ziemlich aussagekräftig. Denn wir leben im Jahr 2018. Warum Inklusion so wichtig ist, hat sich mittlerweile bis in die hintersten Ecken des Internets rumgesprochen.
Und warum ist sie im historischen Roman, oder in einem Historien-RPG, wichtig? Nicht wegen der zweifelhaften „historischen Korrektheit“, die es so gesehen doch eigentlich gar nicht gibt. Sondern, weil wir uns alle gern repräsentiert sehen. Besonders auch in historischen Geschichten. Denn wenn die großen historischen Abenteuer nur von nicht marginalisierten Figuren erlebt werden, dann sagt das auch etwas über die Gegenwart aus und unseren Umgang mit diskriminierten Minderheiten. Wir senden mit unseren Romanen und anderen Medien immer Botschaften, egal wie vehement viele Autor_innen abstreiten, irgendetwas vermitteln zu wollen.
Das ist unvermeidbar. Umso besser, wenn man sich von vorn herein bewusst ist, welche Botschaft man vermittelt. Umso besser, wenn man dazu stehen kann, anstatt sich hinterher hinter einem „Das war aber damals so!“ verstecken zu müssen. Denn das war damals nicht so. Dieses „damals“ ist ein reines Konstrukt, weil historische Medien immer nur Konstrukte sind. Wir können interpretieren. Wir können Vergangenheiten niemals wirklich korrekt abbilden. Wie etwas „damals“ war, ist so viel komplexer, so viel verschachtelter als das und es lässt vor allem so viele Interpretationen und Thesen zu, dass ein „Damals war das aber so!“ schon eine Beleidigung für diese historische Vielfalt ist.
„Für die war das normal“: Die Normalisierung von Gewalt
Ein weiterer Punkt, der gern mal das „Damals war das aber so!“ oder seinen kleinen Cousin „Das fand ich nicht gut, aber damals war das wohl einfach so“, der durch viele Rezensionen geistert, heraufbeschwört, ist die Rechtfertigung von brutalster Gewalt gegen Frauen und nicht selten auch Minderheiten, wie LGBTQ Menschen oder people of colour. Im historischen Roman zum Beispiel wird so viel sexuell missbraucht, dass ich das Genre lange Zeit gemieden habe, denn diese Normalisierung von sexueller Gewalt will ich nicht lesen. Und nichts anderes ist das.
„Das war damals aber so“ wird nämlich gern um „Die kannten das doch nicht anders“ ergänzt und daraus wird sehr schnell ein hässliches „Das war normal für die!“, als wäre das alles dann auch gar nicht so schlimm. Selbst Medien, die ich wirklich sehr gern mag, tappen in diese Falle, denn es ist im Histobereich wohl eins der am hartnäckigsten Klischees, dass die Welt, je weiter man zurückgeht, umso unterdrückender und roher war, als wäre das eine lineare Entwicklung und nicht etwas, das stark von Zeit, Ort und Kontext abhängig ist.
Besonders oft trifft es da das „dunkle“ Mittelalter und die Darstellungen von (sexueller) Gewalt sind so bitter wie flach: Links und rechts wird missbraucht, aber keiner findet das besonders schlimm, Täter werden nicht bestraft, damit musste man, besonders als Frau, halt leben, das „war halt damals so“. Aber auch das ist wieder eine viel zu einfach gedachte Sache, die in Wirklichkeit so viel komplexer ist und so viele verschiedene Möglichkeiten zum Umgang mit dem Thema bereithält. Dieser lapidare Umgang mit einem so komplexen und sensiblen Thema ist in meinen Augen nicht haltbar.
Nicht nur, weil eben auch dieses Thema sehr viel komplexer ist und sehr viel mehr Fingerspitzengefühl verlangt, als das, sondern auch, weil historische Medien am Ende immer noch für moderne Zuschauer_innen gedacht sind. Vor dem Bildschirm sitzen keine Zeitgenossen aus dem 18. Jahrhundert, wenn zum Beispiel „Outlander“ oder „Vikings“ läuft, sondern moderne Zuschauer_innen. Die einschlägigen Historienromane lesen keine mittelalterlichen Menschen, sondern moderne Leser_innen. Und diese Normalisierung von (sexueller) Gewalt macht etwas mit uns. „Damals war das normal, deshalb ist das gar nicht so schlimm!“ beeinflusst auch unsere moderne Perspektive auf diese Probleme.
Ein Schlusswort
Am Ende ist und bleibt „Das ist so aber historisch korrekt!“ eine Ausrede. „Damals war das so!“ ist kein Argument, es ist ein Schutzschild, hinter das man sich stellen kann, um seine oft schwarzweiß gedachten und flach recherchierten historischen Medien zu verteidigen. Aber am Ende ist eines klar: Geschichte kann mehr als das. Sie ist vielfältig. Sie lässt Interpretationsraum und sie kennt keine eindeutigen Fakten und historisch „korrekten“ Wahrheiten. Wir als Autor_innen von historischen Romanen, als Entwickler_innen von Historienspielen, als kreative Personen hinter historischen Medien, treffen Entscheidungen, wenn wir unsere Geschichten entwickeln.
Und diese Entscheidungen hinter einem „Damals war das aber so!“ zu verstecken kann doch nicht das Wahre sein. Macht eure Recherche und macht sie gründlich. Aber seid kritisch, was die Quellen und die Literatur angeht, die ihr dazu benutzt, nehmt sie nicht einfach so als historische Wahrheiten hin. Denn sie sind von Menschen gemacht und oft von Menschen mit Macht. Es gibt Gründe, warum eine Quelle vielleicht nicht erwähnt, dass eine historische Persönlichkeit LGBTQ oder PoC war. Es gibt Gründe, warum Quellen – und moderne Literatur – Vielfalt aller Art in historischen Gesellschaften unterschlagen.
Historischer – und moderner – Kontext ist wichtig. Macht euch damit vertraut und vertraut nicht auf „Das war damals so!“. Es gibt dieses „damals“ nicht. Es gibt viele verschiedene Versionen von „damals“ und am Ende ist keine davon wirklich „richtig“. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass man seine Recherche aus dem Fenster schmeißen sollte. Aber denkt selbst mit, als Schaffende und als Konsumierende. Man muss etwas nicht einfach hinnehmen, nur weil jemand sagt, dass das „damals halt so war“. Denkt immer daran, dass Originalquellen von ihren zeitgenössischen Ideologien und Wertvorstellungen gefärbt sind, genauso wie moderne Literatur von modernen gesellschaftlichen Konventionen, sowie der Intention der Autor_innen.
